Interview mit Till Randolf Amelung
Teil 2: Das affirmative Modell und dessen Alternativen
In Teil 1 haben wir das gender-affirmative Behandlungsmodell erklärt, für die Debatte wichtige Begriffe wie den der Geschlechtsidentität und der Geschlechtsdysphorie beleuchtet. Der Schwerpunkt lag darauf, die Bedeutung des Cass Reviews für dieses affirmative Modell herauszuarbeiten. Das Ergebnis ist glasklar: Aus wissenschaftlicher Perspektive, aus der der evidenzbasierten Medizin, ist dieses Modell unhaltbar. Genau deshalb wurde es vom NHS mittlerweile gestoppt; der Gesetzgeber im UK hat den Einsatz von Pubertätsblockern für Minderjährige landesweit untersagt. Mehrere Länder in Europa ziehen gerade nach. Bevor wir uns in Teil 3 der Frage widmen, wie es überhaupt möglich war, ein derart abstruses „Behandlungsmodell“ so lange durchzuziehen und gegen jede noch so berechtigte Kritik abzuschirmen, werfen wir einen Blick auf die Historie und die anderen Behandlungsmodelle.
Andreas Edmüller (AE): Kannst Du bitte kurz die Geschichte des affirmativen Modells bzw. dessen Umsetzungsstationen beim GIDS skizzieren? Wie hat es angefangen?
Till Randolf Amelung (TRA): Entwickelt wurde das affirmative Modell mit Pubertätsblockern nicht im britischen GIDS, sondern an der Universitätsklinik Amsterdam. Deshalb ist international auch der Begriff Dutch Protocol geläufig. Ein Team um die Kinder- und Jugendpsychiaterin Peggy Cohen-Kettenis begann ab Mitte der 1990er Jugendliche, die schon von früher Kindheit an unter Geschlechtsdysphorie litten, mit GnrH-Analoga, also Pubertätsblockern, zu behandeln. Ziel war es, eine weitere Reifung der biologisch angelegten Geschlechtsmerkmale zu bremsen. Nach einer erneuten Sicherung der Diagnose wurde dann auf Wunsch der jungen Patienten das gewünschte Geschlechtshormon verabreicht und sozusagen eine Pubertät eingeleitet, die körperlich nicht angelegt gewesen wäre.
AE: Ich verstehe nicht, warum man Kinder vor oder in der Pubertät derart einschneidenden Maßnahmen aussetzt - gibt es dafür eine Erklärung?
TRA: Der Grundgedanke bei diesem Vorgehen ist, dass erwachsene Transsexuelle oft psychisch schwer belastet sind. Eine geschlechtsangleichende Behandlung erst im Erwachsenenalter kann nicht alles ungeschehen machen, was sich durch die biologisch angelegte Pubertät vorher entwickelt hat. Gerade Transfrauen leiden mitunter unter markanten Gesichtszügen, Bartwuchs und den Folgen des Stimmbruchs. Mit einer feminisierenden Hormontherapie allein lässt sich das nicht ändern. Das kann im Alltag immer wieder zu Frustration führen, weil man Diskriminierung erlebt oder schlicht, weil man immer ungewollt auffällt.
Und da erwachsene Transsexuelle immer wieder von einem starken Erleben ihrer Geschlechtsdysphorie bereits in früher Kindheit berichten, dachte sich das niederländische Team, man könnte mit frühen Interventionen denjenigen helfen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsene transitionieren würden. Ziel war es, die psychische Gesundheit durch erfolgreichere Angleichungsmaßnahmen zu verbessern.
AE: So viel zu Entstehung, Grundidee und Grundmotivation hinter dem Dutch Protocol bzw. dem darauf aufbauenden affirmativen Behandlungsmodell - wie wurde es dann weiter umgesetzt und verbreitet?
TRA: 1998 erzählten die Amsterdamer Ärzte erstmals von ihrem „Patient 0“, einem biologisch weiblichen Teenager. Sie bekam mit 13 Jahren GnrH-Analoga zur Pubertätsblockade und verlangte dann mit 16 geschlechtsangleichende Eingriffe. 2011 wurde erstmals eine Studie zu mehreren Patienten veröffentlicht, die nach diesem Modell behandelt wurden. Das Dutch Protocol war tatsächlich ein völlig neuer Ansatz, denn vorher galt der Grundsatz, Geschlechtsangleichungen erst im Erwachsenenalter durchzuführen und bei Minderjährigen ausschließlich Psychotherapie einzusetzen.
Ab den 2000er Jahren verbreitete sich das Dutch Protocol in der westlichen Welt. In vielen Ländern gab es eine Handvoll Psychiater, die sich um Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie kümmerten und die euphorisch auf die frohe Kunde aus Amsterdam reagierten. Man hatte es ja mit jungen Patienten zu tun, von denen einige psychisch schwer belastet waren: Mit dem neuen Ansatz konnte man jetzt noch etwas anderes anbieten als bloße Therapiegespräche.
Binnen weniger Jahre wurde das Dutch Protocol international zum Standardvorgehen, um Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie zu behandeln. Noch euphorischer allerdings reagierten Transaktivisten, Eltern und ihre geschlechtsdysphorischen Zöglinge.
AE: Auf diese Aktivisten gehen wir später ausführlich ein. Wie kam das Modell dann zum GIDS an die Tavistock Klinik nach London?
TRA: Auch am GIDS in London folgte man schließlich dem niederländischen Beispiel. Die 1989 gegründete Ambulanz hatte bis dahin wie alle anderen nur Psychotherapie angeboten. Nun aber wünschten sich auch geschlechtsdysphorische Minderjährige und ihre Erziehungsberechtigten, der GIDS möge sich ein Beispiel an Amsterdam nehmen.
Auch Transaktivisten haben öffentlich Druck gemacht: Wer dem niederländischen Modell mit Pubertätsblockern nicht folgte, sah sich schnell dem Verdacht der Transphobie ausgesetzt. Detailliert und lesenswert hat die Entwicklungen im GIDS von seiner Gründung bis zur Schließung die Journalistin Hannah Barnes recherchiert und geschildert.[1]
AE: Wie haben sich denn insgesamt die Behandlungsansätze für Geschlechtsdysphorie im Lauf der Zeit verändert?
TRA: Das erste Modell, vertreten von Dr. Susan Bradley und Ken Zucker aus Kanada in den 1980ern, geht davon aus, dass Kinder in ihrer psychischen Entwicklung noch formbar sind und dass die Behandlungsziele darin bestehen können, einem Kind zu helfen, das eigene biologische Geschlecht zu akzeptieren. Bradley und Zucker haben in diesem Bereich auch beachtenswerte Forschungen vorgelegt. Dazu gehören Erkenntnisse, dass die meisten dieser Kinder und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie im weiteren Lebensverlauf ein homosexuelles Coming-out haben. In diesem Modell würden Schritte einer Geschlechtsangleichung nicht vor dem Erwachsenenalter erfolgen.
AE: Das heißt, dass sich die Selbsteinschätzung der Geschlechtsidentität bei vielen dieser Kinder über die Pubertät hinweg noch einmal geändert hat?
TRA: Ja, genau.[2] Das zweite Modell entspricht dem eben skizzierten niederländischen Ansatz und besagt, dass ein Kind bereits in jungen Jahren sicheres Wissen über seine Geschlechtsidentität haben kann, aber bis zur Pubertät warten sollte, bevor es sich auf einen vollständigen Übergang von einem Geschlecht zum anderen einlässt. Die Niederländer stellten folgende Kriterien auf: Die jungen Patienten mussten die diagnostischen Kriterien für eine Geschlechtsidentitätsstörung erfüllen, wie es damals genannt wurde. Sie mussten zudem lebenslang unter extremer Geschlechtsdysphorie gelitten haben, psychisch stabil sein und in einem unterstützenden Umfeld leben.
AE: Wenn ich das richtig verstehe, dann hätten die Niederländer viele der Kinder, die später beim GIDS Pubertätsblocker bekamen, gar nicht behandelt, weil sie das Kriterium der psychischen Stabilität nicht erfüllten? Außerdem kann von einer routinemäßigen seriösen Diagnostik beim GIDS meines Erachtens auch keine Rede sein.
TRA: Ja, so ist es. Später kritisierte Thomas Steensma, einer der Ärzte aus dem Team der niederländischen Pioniere, in einer niederländischen Zeitung, dass viele andere einfach ihre Arbeiten übernommen hätten, anstatt eigene Forschung durchzuführen. Steensma war selbst über die Entwicklungen mit den steigenden Zahlen vor allem unter biologisch weiblichen Teenagern besorgt, die es ja nicht nur im britischen GIDS gab, sondern in allen westlichen Staaten, wo der affimative Ansatz mit Pubertätsblockern verfügbar war.[3]
AE: Das affirmative Modell hat dann wohl die Einschränkungen der Niederländer über Bord geworfen?
TRA: Stimmt. Das dritte Modell, das aktuelle gender-affirmative, basiert auf der Annahme, dass ein Kind in jedem Alter seine korrekte Geschlechtsidentität erkennen und in jedem Entwicklungsstadium von einer Geschlechtsangleichung profitieren kann. Entstanden ist dieser Ansatz in den USA, wo das Dutch Protocol ab 2007 aufgenommen wurde. Eine besonders populäre Vertreterin ist die Psychologin Diane Ehrensaft, die 2016 ihr Buch „The Gender Creative Child: Pathways for Nurturing and Supporting Children Who Live Outside Gender Boxes“ veröffentlichte.[4] Dieses Modell sieht zugleich vor, dass diese selbst erkannte Identität nicht mit psychiatrischer Differenzialdiagnostik hinterfragt werden dürfe, solche Maßnahmen gelten als „Gatekeeping“ oder sogar „Konversionstherapie“.[5]
AE: Um die Unterschiede der jeweiligen Behandlungsmodelle noch besser zu verstehen, wäre es hilfreich, wenn wir uns ein paar reale Beispiele anschauen. Vorher aber noch zu Dir: Deine breite Akzeptanz als viel beachteter Kritiker des affirmativen Modells und des Transaktivismus hat ja auch mit Deinem Werdegang zu tun. Könntest Du uns Deinen Hintergrund kurz skizzieren?
TRA: Meine eigene Geschlechtsangleichung habe ich 2006 begonnen und formal mit den letzten Schritten 2011 abgeschlossen. Zusätzlich habe ich schon während meines Studiums begonnen, mich zum Thema Trans zu engagieren – zunächst lokal und regional. Darüber habe ich mich dann auch mit anderen Aktivisten deutschlandweit vernetzt und daher einiges an politischen Diskussionen und Entwicklungen mitbekommen. Ich stand zuerst mehr auf der Seite derer, die ich nun scharf kritisiere.
AE: Du weißt also genau, wovon wir hier reden und worum es geht. Was hat Deine kritische Haltung geformt?
TRA: Ab 2016 gab es mehrere Ereignisse, die mich Schritt für Schritt dem Transaktivismus und gender-affirmativen Ansatz entfremdeten. Vorher war ich dem Einsatz von Pubertätsblockern gegenüber eher oberflächlich positiv eingestellt. Das war vor allem durch mehrere SternTV-Reportagen über Kim Petras geprägt, die ab 2006 gezeigt wurden. Petras hat im Alter von 12 Jahren Pubertätsblocker bekommen, später weibliche Hormone. 2008 wurde sie im Alter von 16 Jahren genitalangleichend operiert und ist damit die weltweit jüngste Person, an der jemals so ein Eingriff aus Transgründen vorgenommen wurde. Ich dachte mir, die Ärzte werden schon wissen, was sie da machen und es ist doch toll, wenn Kinder und Jugendliche mit Leidensdruck früh unterstützt werden.
AE: Keine Ahnung, warum Ärzte immer noch so viel Vertrauen genießen. Das kommt wahrscheinlich von den ganzen Fernsehserien. Dazu eine Buchempfehlung: Bad Medicine von David Wootton.[6] Diesen Aspekt können wir hier leider nicht vertiefen - aber die Ärzte haben sich bei dem Thema als Berufsstand wieder einmal mit etwas ganz anderem als Ruhm bekleckert.
TRA: Es gibt aber auch die Kombination aus Kompetenz und Zivilcourage. Ein sehr früher Kritiker von Pubertätsblockern in Deutschland war der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte, der deshalb schon damals von Transaktivisten angefeindet wurde. Als ich um 2018 herum eine damalige Bekannte fragte, eine Transfrau mit naturwissenschaftlicher Ausbildung, ob es denn gar keine Risiken bei Pubertätsblockern gebe, antwortete sie trocken: „Im Prinzip das, was Korte schreibt“. Da fand ich dann den diffamierenden Umgang mit ihm sehr irritierend.[7]
Online konnte ich beobachten, wie sich immer mehr junge Menschen mit dem Thema Trans auseinandersetzten. Seit 2019 war ich nach langjähriger Mitgliedschaft Moderator in der größten deutschsprachigen Facebookgruppe, die von einer Transfrau gegründet wurde. Man konnte über Jahre sehen, wie sich die Klientel veränderte: Sie wurde jünger, mit zunehmend vielen biologisch weiblichen Personen. Und bei immer mehr Selbstbeschreibungen hatte ich immer weniger ein gutes Gefühl, einfach nur den Weg zu erklären, wie man an geschlechtsangleichende Behandlungen kommt: Da lief etwas aus dem Ruder!
Ich war schon immer jemand, der es wichtig findet, dass eine Geschlechtsangleichung gut begleitet wird, gerade wenn es um Hormone und Operationen geht. Da es sich hier nicht wie bei einem Beinbruch mit klarer Diagnostik und Behandlung verhält, sondern ein psychotherapeutisch explorativer Prozess wichtig ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, dass der erste Schritt der Gang zu einem erfahrenen Psychotherapeuten ist. Sowohl bei Kindern und Jugendlichen, als auch bei Erwachsenen. In „meiner“ Facebookgruppe sehen wir vom Moderatorenteam Psychotherapie nicht als Übel oder diskriminierendes Hindernis, sondern als wichtige Unterstützung.
Damit hatten wir allerdings bald eine Minderheitenposition. Fast alle anderen Transgruppen und vor allem Lobbyorganisationen bezeichneten Psychotherapie als „diskriminierend“, „pathologisierend“ und „Gatekeeping“, also als Einschränkung der individuellen Persönlichkeitsrechte. Auch innerhalb unserer Gruppe kam es immer mehr zwischen uns und diesen Aktivisten zu Streitereien. Inzwischen sind wir diese Leute los und sie uns aber auch.
AE: Danke für Deine offenen Worte - und jetzt zu den konkreten Beispielen: Könntest Du bitte einige Deiner persönlichen Erfahrungen zum Thema Behandlung von Geschlechtsdysphorie mit uns teilen? Ich glaube, das ist für unsere Leser wichtig, damit sie sich ein realistisches Bild der jeweiligen Behandlungsmodelle machen können.
TRA: Ich möchte kurz fünf Begebenheiten erwähnen, die mich immer mehr auf die kritische Seite gezogen haben:
Erstens: Es dürfte so ab 2017/18 gewesen sein, da verfolgte ich in „meiner“ Gruppe den Weg einer gerade volljährig gewordenen biologisch männlichen Person, die eine Angleichung zur Frau anstrebte. Auf mich wirkten mehrere ihrer Beiträge so, dass sich da jemand seiner selbst absolut nicht sicher ist. Deshalb empfahlen wir, die Begleittherapie zu nutzen. Nach einer Weile hat diese Person in eine andere Gruppe gewechselt und wir bekamen aus der Ferne mit, wie schnell das bis hin zur genitalangleichenden OP gegangen ist. Der junge Mensch wurde im Eiltempo regelrecht auf die OP-Liege gecoacht.
Die fragliche Gruppe gehörte zum Nahfeld einer Lobbyorganisation, die sich der Qualität ihrer Beratung rühmt. Doch bald tauchte der junge, mittlerweile operierte Mensch wieder in „meiner“ Gruppe auf und bereute ganz offen die OP. Wir erfuhren außerdem, dass es ernste Komplikationen gegeben hatte. In der anderen Gruppe fühlte man sich offenbar dafür nicht mehr zuständig. In den kommenden Jahren gab es dann ein ständiges Auf und Ab und gleichzeitig sehr extreme Äußerungen gegen die OP, unrealistische Szenarien zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands usw.; teils in drastischer Sprache.
Ich konnte mich irgendwann mit einer anderen Transfrau austauschen, die von der jungen Person ebenfalls kontaktiert wurde. Es war schon sehr belastend. Denn auch wir konnten sie im Grunde nur an professionelle Therapeuten weiterverweisen. Der ganze Fall überstieg unsere Kompetenz als Laien in der Selbsthilfe. Irgendwann erfuhr ich, dass es eine Schizophreniediagnose gab und nach langer Instabilität hat die Person, so mein letzter Stand, ihren Frieden mit der Transition gefunden.
Aber, worauf es ankommt: Von der anderen Gruppe hat nie jemand Verantwortung für das misslungene und übereilte OP-Coaching übernommen. Stattdessen erfuhr ich, dass man die junge Person bezichtigte, alle nur „verarscht“ zu haben. Da wusste ich, es gibt keinerlei Ressourcen zur Selbstkorrektur mehr.
Ein zweites Ereignis stammt aus derselben Gruppe dieser aktivistischen Lobbyorganisation. Es war auch so um 2018/19, als eine damals noch für die Lobbyorganisation als Beraterin tätige Transfrau einen Beratungsfall schilderte, bei dem sie nicht weiterwusste. Es ging um eine gerade volljährige, biologisch weibliche Klientin, die sich als „nonbinary“ fühle und eine „Uterusphobie“ habe, also sich die Gebärmutter entfernen lassen wolle. Kinderwunsch habe sie nicht, sie wolle „Jungfrau“ bleiben.
Die Beraterin wollte nun von der Gruppe wissen, wie sie der jungen Frau zur Hysterektomie verhelfen könne. Ein Bekannter von mir fand das wie ich verantwortungslos und wir sagten das auch. Wir plädierten dafür, erst einmal näher die Gründe zu erfragen, die diese junge Frau antrieben. Aber da waren der Bekannte und ich plötzlich böse „Gatekeeper“. So etwas war unerwünscht. Aus dem Lobbyverein widersprach da auch niemand. Soviel also zur hervorragenden Beratungsqualität.
Drittens: Ebenfalls um 2019 kam in „meine“ Gruppe eine Mutter von zwei Söhnen, bei dem der eine – mitten in der Pubertät – mit seinem Geschlecht haderte, aber die Geschlechtsdysphorie gegenüber dem Körper war wohl nicht so intensiv. Laut Mutter hatte es erst kürzlich ein schwules Coming-out gegeben. Andere Gruppenmitglieder warfen sofort Pubertätsblocker in den Raum. Ich war einer der ganz wenigen, der empfahl, erst ohne irgendwelche Medikamente die Thematik zu ergründen. Pubertätsblocker mit allen bekannten und unbekannten Risiken sind zu einer selbstverständlichen Antwort geworden - das hat mich doch sehr erschreckt.
Viertens: Ein ebenfalls bemerkenswerter Fall war ein junger, gerade 19jähriger Transmann, der sehr früh Pubertätsblocker bekam. Nun war er in einer Beziehung mit einem anderen jungen Mann und es ging um einen Kinderwunsch. Doch eine Behandlung mit Pubertätsblockern mit anschließender Gabe von gegengeschlechtlichen Hormonen macht unfruchtbar. Der Transmannn tauchte über einige Zeit immer wieder mit diesem Thema in „meiner“ Facebookgruppe auf - das Fortpflanzungsthema ist eben doch keine Petitesse.
2024 wurden übrigens Beiträge aus einem Austauschforum der WPATH geleakt, aus denen deutlich wurde, dass ein Fall wie der dieses jungen Transmannes anderen Behandlern schon öfter begegnet ist.[8] Die Kinder und Jugendlichen sagen, sie könnten sich ja z.B. einen Hund anschaffen, eigene Kinder seien ihnen nicht wichtig. Aber: Als junge Erwachsene sitzen dieselben Patienten dann wieder bei den Ärzten und hadern mit dem nicht mehr erfüllbaren Kinderwunsch. In den geleakten Beiträgen sagte ein Arzt, wenn man mit den jungen Patienten über Sexualität und Fortpflanzung rede, sei es, als rede man mit einer Wand.
Es ist einfach ein Irrglaube, dass sehr junge Menschen eine informierte Entscheidung in solchen Fragen treffen können. Hier liegt das affirmative Modell einfach fundamental falsch. Insofern war die Urteilsbegründung im Bell-Prozess durchaus korrekt.
Ein fünfter Fall aus „meiner“ Facebookgruppe ist ein junger Transmann, ebenfalls gerade volljährig. Er fragte, ob man sexuelle Gewalt erfahren haben und trotzdem zugleich trans sein könne. Im Privataustausch kam heraus, dass er innerhalb der Familie früh sexuellen Missbrauch erlebt hat, seinen Eltern das nie erzählt habe, aber dann früh einen Geschlechtswechsel wollte, deshalb Pubertätsblocker bekam, etc. Den letzten Schritt der Genitalangleichung ist er dann erstmal nicht gegangen, da kamen doch Unsicherheiten auf. Ich habe ihm empfohlen, auch nach vorn zu schauen, mit Hilfe von guter therapeutischer Unterstützung, was für ihn lebbar ist.
AE: Solche konkreten Fälle geben natürlich zu denken. Wie repräsentativ sind sie Deiner Meinung nach?
TRA: Meine Fälle mögen Einzelfälle sein, aber sie passen in das Gesamtbild, wie ja auch Cass für den GIDS gezeigt hat. Unter den GIDS-Patienten (und besonders den Patientinnen) waren überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche aus dysfunktionalen Familienverhältnissen, haben sexuellen Missbrauch erlebt, eine krisenhafte homosexuelle Entwicklung, mehrere psychische Begleiterkrankungen, Autismus … Was Cass festgehalten hat, wurde auch in anderen Ländern festgestellt; aus Schweden und Finnland berichtete man Ähnliches.
Doch im Transaktivismus will man nicht wahrhaben, dass eine Transition eine falsche Entscheidung sein könnte. „Dann hat die Person eben Pech gehabt …“ - so etwas in der Art kriegt man dann zu hören.
AE: Für mich klingt das so kaltschnäuzig wie menschenverachtend. Gibt es da auch so etwas wie Argumente?
TRA: Eine meines Erachtens sehr verdrehte Kritikabwehr ist das Argument der US-amerikanischen Transaktivistin Julia Serano, die selbst das Bewahren vor Fehlentscheidungen als „transphobe Doppelmoral“ sieht. Die gehe davon aus, dass cisgeschlechtliche (d.h. nicht-transgeschlechtliche) Körper, Identitäten und Erfahrungen gültig und die unausgesprochene Norm seien, während ihre transgeschlechtlichen Gegenstücke im Vergleich als illegitim, unauthentisch, defekt und verdächtig gelten.
AE: Das läuft dann auf den Schluss hinaus, dass man eh nichts falsch machen kann, oder?
TRA: Stimmt. Das geht gegen mein ethisches Empfinden, ich halte so eine Güterabwägung für arg verrutscht. Es ist nicht nur die unzureichende Evidenzlage beim Ansatz mit Pubertätsblockern. Auch für Erwachsene gibt es kaum Langzeitstudien. Die es gibt, zeigen inzwischen, dass die Hormontherapie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Das passt für mich alles nicht gut zueinander. Mir geht es gut, mit meiner Entscheidung für eine Transition. Und ich möchte, dass es anderen ebenfalls gut geht. Dazu muss man aber auch Kontraindikationen sehen und klar benennen. Und in einem kompetenten Behandlungsmodell berücksichtigen. Für den Transaktivismus und seine Verbündeten ist das alles transphobes „Gatekeeping“.[9]
AE: Ich nehme an, Du hast auch schon den einen oder anderen Shitstorm erleben müssen?
TRA: Viele Transaktivisten lehnen mich mittlerweile ab und einige stellen mich auch in die Nähe von Rechtsextremismus. Ich wurde auch schon als „transphob“ beschimpft …
AE: Zum woken Transaktivismus kommen wir dann in Teil 3 - ich freue mich schon jetzt drauf. Kannst Du uns vorher bitte noch die wesentlichen Komponenten eines fachlich angemessenen und moralisch akzeptablen Behandlungsmodells skizzieren? Das wäre für unsere Leser noch einmal eine wertvolle Zusammenfassung einer komplexen Thematik. Und es hilft dabei, die Vorwürfe gegen Dich realistisch und angemessen einschätzen zu können.
TRA: Vor Maßnahmen im Rahmen einer Geschlechtsangleichung braucht es eine sorgfältige psychiatrische und somatische Diagnostik inklusive Sexualanamnese sowie einen längeren Prozess, in dem man sich mit den ganz persönlichen Gründen und Erwartungen in Bezug auf eine Transition auseinandersetzt. In der Medizin sollten wir klare Kriterien haben, wann von einer Transition abgeraten werden muss. Zusätzlich sind Behandlungsansätze wichtig, die diejenigen mit Geschlechtsdysphorie unterstützen, die keine Geschlechtsangleichung anstreben können oder sollten.
AE: Das klingt plausibel - ich glaube, unsere Leser können das affirmative Modell jetzt ganz gut einschätzen.
Hier geht es zu Teil 1.
Hier geht es zu Teil 3.
Till Randolf Amelung ist Redakteur des Blogs der Initiative Queer Nations e.V. und seit Juli 2024 auch Mitglied dessen Vorstands. Als freier Autor liegt sein Schwerpunkt auf geschlechterpolitischen Themen – Artikel von ihm sind zum Beispiel in der Jungle World, dem Ruhrbarone-Blog, konkret, Welt am Sonntag, Berliner Zeitung, Zeit Online erschienen. Ebenso veröffentlicht er in wissenschaftlichen Anthologien wie dem Jahrbuch Sexualitäten . 2020 gab er im Querverlag den Sammelband Irrwege – Analysen aktueller queerer Politik heraus. 2022 erschien sein Essay Transaktivismus gegen Radikalfeminismus. Gedanken zu einer Front im digitalen Kulturkampf. 2023 war er auf Einladung der CDU/CSU Sachverständiger zum Selbstbestimmungsgesetz im Familienausschuss des Bundestags. Studium der Geschichtswissenschaften und Geschlechterforschung an der Georg-August-Universität Göttingen.
Dr. Andreas Edmüller hat in München und Oxford Philosophie, Logik/Wissenschaftstheorie und Linguistik studiert. Seit seiner Habilitation 1996 ist er Privatdozent für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Moral-, Rechts- und Staatsphilosophie. Von 1991 bis 2019 war er zudem als selbstständiger Unternehmensberater tätig und hat mit Dr. Thomas Wilhelm das „Projekt Philosophie“ ins Leben gerufen. 2015 veröffentlichte er im Tectum-Verlag ein religionsphilosophisches Buch unter dem Titel „Die Legende von der christlichen Moral: Warum das Christentum moralisch orientierungslos ist“. Im Dezember 2021 erschien Band 1 der Reihe »Dossier Verschwörungstheorie« unter dem Titel „Verschwörungsspinner oder seriöser Aufklärer? – Wie man Verschwörungstheorien professionell analysiert“, im Juli 2023 Band 2 (mit Judith Faessler) unter dem Titel „Verschwörungstheorien als Waffe – Wie man die Tricks der Verschwörungsgauner durchschaut und abwehrt“, beide im Rediroma-Verlag. (Text: Kortizes)
Fußnoten
[1] https://swiftpress.com/book/time-to-think/
[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-024-02817-5
[4] https://www.amazon.de/dp/B0CQK9RCLV
[5] https://segm.org/Dutch-protocol-debate-Netherlands
[6] David Wootton: Bad Medicine. Doctors Doing Harm Since Hippocrates. Oxford University Press, 2006.
[7] Vor kurzem ist Alexander Kortes exzellentes Buch zum Thema erschienen: Hinter dem Regenbogen: Entwicklungspsychiatrische, sexual- und kulturwissenschaftliche Überlegungen zur Genderdebatte und zum Phänomen der Geschlechtsdysphorie bei Minderjährigen. Kohlhammer, 2024.
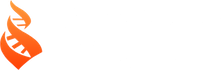


Kommentare
Vielen Dank für den 2. informativen Teil und insbesondere an Till Amelung, dass er seine eigene Geschichte und Erfahrungen hat einfließen lassen.
Antworten
Ja, da stimme ich zu. Persönliche Erfahrungen zu schildern ist gerade bei diesem Thema sehr wichtig, weil sehr viele darüber nur sehr wenig wissen. Und nur über diese Erfahrungen kann man sich ein realistisches Bild der Lage bzw. Thematik machen. Das ging mir genauso ...
Antworten
Neuer Kommentar